
Sola-Gratia-Verlag
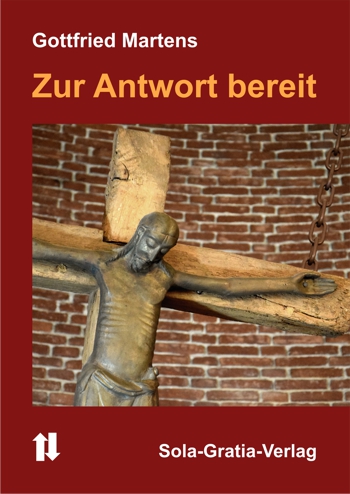
Hilfen zum Gespräch über den christlichen Glauben
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in Deutschland in Fragen des christlichen Glaubens ein gewaltiger Traditionsabbruch vollzogen: Nur noch wenigen Menschen sind die zentralen Inhalte des christlichen Glaubens bekannt. Die Argumente für das Desinteresse und die fehlenden Kenntnisse dieser Inhalte sind immer wieder dieselben. Umso wichtiger wird es immer mehr, dass nicht allein ausgebildete Theologen, sondern Gemeindeglieder über ihren Glauben sprechen, von ihm Rechenschaft ablegen und auf Argumente gegen den christlichen Glauben Antworten geben können.
Diesem Ziel sollten die Glaubensinformationen dienen, die der Verfasser dieses Buches bereits vor 20 Jahren den Gliedern seiner damaligen Gemeinde in Berlin-Zehlendorf mit jedem Pfarrbrief zukommen ließ. Sehr bald wurden sie auch in anderen Gemeinden verbreitet; immer wieder wird nach ihnen gefragt. Nun sind zwei Jahrgänge dieser Glaubensinformationen in diesem Buch zusammengestellt. Sie haben an Aktualität noch weiter gewonnen und sollen dazu dienen, Gemeindegliedern gleichsam ein Instrumentarium in die Hand zu geben, um in Diskussionen über den christlichen Glauben sprachfähig zu sein. Wir haben als Christen keinen Grund, verschämt zu schweigen…

E-Book (Format EPUB)
hier herunterladen!
KOSTENLOS Verlags-Nummer 033-01-22

E-Book (Format Mobipocket/Kindle)
hier herunterladen!
KOSTENLOS Verlags-Nummer 033-01-23

E-Book (PDF-Datei)
hier öffnen / herunterladen!
KOSTENLOS Verlags-Nummer 033-01-21

Softcover, 116 Seiten
Bestellungen beim Verlag (s. Kontakt)
PREIS 6,00 Euro ISBN 978-3-948712-16-7
LESEPROBE:
Das Argument, jeder Mensch solle seinen eigenen Glauben haben, richtet sich gegen die missionarische Ausrichtung des christlichen Glaubens, die in der Tat zum christlichen Glauben wesenhaft dazugehört: „Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.“ (Apostelgeschichte 4,20) Bei diesem Reden geht es nicht bloß um die Mitteilung der persönlichen Befindlichkeit; vielmehr zielt dieses Reden ganz bewusst darauf, das Gegenüber ebenfalls für den Glauben an Christus zu gewinnen. Es geht im christlichen Glauben eben nicht bloß darum, dass es gut tut, „an irgendetwas zu glauben“; es ist dem christlichen Glauben zufolge gerade nicht egal, woran man glaubt.
Nicht als Aufforderung, sondern als Beschreibung und Feststellung finden wir die Behauptung, jeder Mensch habe einen eigenen Glauben, bereits in den lutherischen Bekenntnisschriften: „Die zwei gehören zuhauf, Glaube und Gott. Woran du nun, sage ich, dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott“, erklärt Martin Luther im Großen Katechismus. Auf diesem Hintergrund gibt es nach christlichem Verständnis keinen ungläubigen Menschen. Die Frage ist nicht, ob ein Mensch an Gott glaubt, sondern an welchen Gott er glaubt. Das heißt aber nun gerade nicht, dass es von daher egal wäre, woran ein Mensch glaubt, wenn ohnehin jeder Mensch an „irgendetwas“ glaubt. Denn nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift gibt es den entscheidenden Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf: Wo Geschaffenes vergöttert wird, indem man sein Herz daran hängt – seien es nun Geld und Besitz, das eigene Ego, ein Hobby oder etwa auch Sternzeichen oder Glücksbringer –, wird der Glaube zum Aberglauben pervertiert. Und zu diesem Geschaffenen gehören eben auch selbstgebastelte religiöse Vorstellungen, ganz gleich, welches Bastelmaterial man dafür verwendet hat.
Doch mit dieser Einsicht, dass jeder Mensch etwas hat, woran er sein Herz hängt, was für ihn das Wichtigste im Leben ist und von daher die Stelle Gottes einnimmt, haben wir noch nicht den Kern der Problematik erfasst, die sich in dem Argument, jeder Mensch solle seinen eigenen Glauben haben, verbirgt. Glauben wirkt sich aus in der Form von Bewusstseinsbindungen, hat, um es mit einem Fachausdruck zu formulieren, seinem Wesen nach immer dogmatischen Charakter. Denn Dogmen sind nichts anderes als solche Bewusstseinsbindungen, die nicht mehr hinterfragt werden können und sollen. Das Problem besteht nun jedoch darin, dass man in der Regel die eigenen Dogmen nicht als Dogmen, sondern als evidente Wahrheit wahrnimmt und von daher das Wort „Dogma“ oftmals geradezu als Schimpfwort gebraucht: Für sich selber nimmt man in Anspruch, „undogmatisch“ zu sein, während man dem Anderen vorwirft, an Dogmen zu hängen. Dieser Mangel an Selbstwahrnehmung führt immer wieder zu ganz charakteristischen „Dogmenkonflikten“, bei denen Menschen auf die Position des jeweiligen Gegenübers hochemotional reagieren, weil sie die eigene Bewusstseinsbindung in Frage stellt. Typisch „dogmatische“ Einwände in Diskussionen um Fragen des christlichen Glaubens sind beispielsweise Formulierungen wie „Das kann man doch heute nicht mehr sagen!“, oder: „Das ist doch einfach so.“ Weh dem, der es wagt, solche Dogmen noch zu hinterfragen! Zu den Dogmen, die hinter solchen Einwänden stehen, gehört beispielsweise auch ein bestimmtes Geschichtsbild, wonach sich die Wahrheitserkenntnis der Menschen immer weiter entwickelt und es von daher geradezu selbstverständlich ist, dass das, was „heute“ gedacht wird, richtig und was früher einmal gedacht wurde, falsch ist.
In dieses Geschichtsbild passt dann auch das heute weit verbreitete sogenannte postmoderne Verständnis von Wahrheit, das sich in vielen Fällen hinter dem Argument, jeder Mensch solle doch seinen eigenen Glauben haben, verbirgt. Diesem postmodernen Wahrheitsverständnis zufolge gibt es gar nicht „die Wahrheit“, sondern jeder Mensch hat seine eigene persönliche, subjektive Wahrheit, die von außen gar nicht in Frage gestellt werden kann oder darf. Von daher kann der Glaube eines Menschen von vornherein nicht falsch oder richtig sein, sondern er kann höchstens für den betreffenden Menschen ganz persönlich falsch und richtig sein. Was der eine als falsch empfinden mag, ist für einen anderen eben gerade richtig. Dies klingt alles sehr tolerant. Doch die Grenzen dieser Toleranz sind bezeichnenderweise dort schnell erreicht, wo es jemand wagt, dieses postmoderne Wahrheitsverständnis selber in Frage zu stellen und sich ihm nicht zu unterwerfen. Auch hier brechen dann sehr schnell Dogmenkonflikte auf, die das postmoderne Gegenüber dadurch für sich zu entscheiden sucht, dass es zur „Fundamentalismus-Keule“ greift und jeden, der sein Wahrheitsverständnis nicht teilt, als Fundamentalisten diffamiert und damit gleich in die entsprechende Schublade steckt.
Als Christen wissen wir, dass die Wahrheit des christlichen Glaubens sich nicht in der Form mathematischer Formeln ausdrücken lässt, sondern rückbezogen ist auf die Person Jesu Christi, der von sich selbst allerdings behauptet: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ (Johannes 14,6) Christus gebraucht hier jeweils ganz bewusst den bestimmten Artikel, für den im postmodernen Denken kein Platz mehr ist, und erhebt damit in der Tat einen Anspruch, der sich durchaus als „Absolutheitsanspruch“ bezeichnen lässt. Zu diesem Absolutheitsanspruch der Person Christi muss sich der Glaube eines jeden Menschen in irgendeiner Weise verhalten – sei es, dass er diesem Anspruch zustimmt, oder sei es, dass er ihn ignorierend oder protestierend ablehnt. So fällt angesichts dieses Selbstanspruchs Christi zugleich auch eine Entscheidung darüber, wie ich Glauben und damit auch „meinen eigenen Glauben“ verstehe: Ist er nicht mehr als meine menschliche Vorstellung vom Leben und von Gott, besteht eine Funktion von daher wesentlich darin, eine Art von „Wohlfühlhilfe“ für bestimmte Anlässe des Lebens zu sein? Oder bezieht sich mein Glaube auf eine Realität außerhalb meiner selbst, an die ich nicht dadurch heranreiche, dass ich mich ihr mit meinen Vorstellungen nähere, sondern dass sich diese Realität mir gegenüber öffnet?